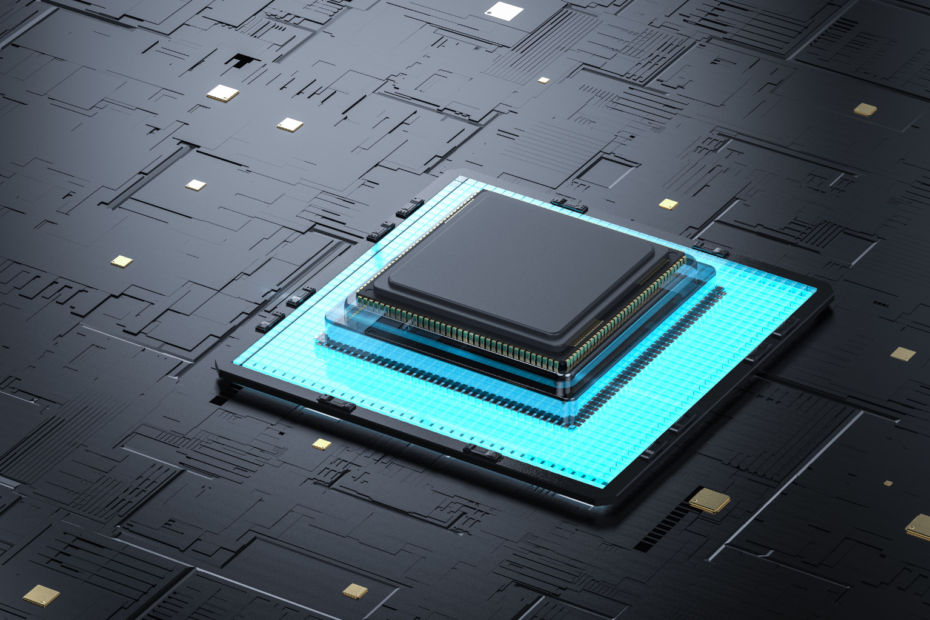Kaum eine internationale Wahl wurde in Deutschland so gespannt verfolgt wie die US-Wahl 2020. Donald Trump, der zur Wiederwahl antrat, spaltete die Gemüter, nicht nur in seinem eigenen Land. Manch einer fragte sich: Wie kann es sein, dass Meinungen und Ansichten, obwohl sie scheinbar auf den gleichen verfügbaren Informationen basieren, so voneinander abweichen? Nun, die schlichte Antwort ist: In unserer digitalen Welt sehen wir nicht alle die gleichen Fakten, wir sind in sogenannten Filterblasen.

Bereits Donald Trumps erster Amtstag begann mit einer Lüge. Als man sich später mit einer Richtigstellung konfrontiert sah, bezeichnete man Trumps Aussage schlicht als „alternative Fakten“. Damit wurde erstmals ein Phänomen in Worte gefasst, das Ausdruck einer neuen Art der Diskussion ist. Falschbehauptungen werden, selbst entgegen klarer wissenschaftlicher Erkenntnisse, als Mittel des öffentlichen Diskurses legitimiert. Besonders häufig erleben wir dies im digitalen Raum. Donald Trump befeuerte durch seine Handlungen und seinen Einsatz von sozialen Medien im Wahlkampf die Debatte um die Regulierungen von sozialen Medien.
Was sind Filterblasen?
Der Politaktivist Eli Pariser erwähnte den Begriff Filterblase zum ersten Mal in einem seiner Bücher im Jahr 2011. Ihm war aufgefallen, dass er auf Facebook Beiträge von besonders konservativen Freunden weniger zu lesen bekam, als die von eher liberalen Kontakten. Dementsprechend prägte er den Begriff Filterblasen als das Phänomen, wenn gezielt Informationen in sozialen Medien und Suchmaschinen gefiltert werden.
Welchen Einfluss haben Soziale Medien?
Soziale Medien sind nicht der alleinige Grund für die Polarisierung einer Gesellschaft, doch sie ermöglichen Gruppenbildungen. Besser als jemals zuvor lassen sie uns Gleichgesinnte finden. Gemäß der Theorie des digitalen Tribalismus, bilden Menschen natürlicherweise Gruppen, während Externe ausgeschlossen werden. Gleichzeitig suchen Menschen im Netz gezielt nach Informationen, die die eigene Identität bestätigen. Dieses Phänomen wird auch als Echokammer-Effekt bezeichnet. Dieser wird von sozialen Netzen und ihren Algorithmen verstärkt. Um das Interesse der Nutzer möglichst lange zu fesseln, werden uns online insbesondere solche Personen und Inhalte gezeigt, die sich mit den eigenen Ansichten decken. Abweichende Meinungen verschwinden dann mehr und mehr aus dem Blickfeld.
Während Falschinformationen für sich genommen relativ harmlos sind, werden sie in Kombination mit den beschriebenen Effekten zu einer erheblichen Gefahr für unsere eigene Meinungsbildung. Algorithmen können das kritische Hinterfragen von Sachverhalten erschweren, wenn Nutzer nur einseitige Informationsquellen zur Verfügung gestellt werden. Wenn uns aber nur noch solche Nachrichten erreichen, die sich mit den eigenen „Fakten“ decken, bleibt eine Richtigstellung von Falschinformationen aus und wir sind in der Filterblase gefangen. In Konsequenz können sich inkorrekte Überzeugungen herausbilden. Soziale Medien können dazu führen, dass Menschen sich von der Realität entkoppeln, dass Fakten für sie an Glaubwürdigkeit verlieren.
Was kannst Du gegen Filterblasen tun?
- Beziehe Informationen analog: Wie wir gesehen haben, handelt es sich bei Filterblasen um ein Problem, das im digitalen Umfeld auftritt. Versuche also wenn möglich bei der Informationssuche auch auf analoge Ressourcen, wie Bücher oder Zeitschriften zurückzugreifen. Das mag zwar der krasseste und aufwendigste Schritt sein, aber leider auch der effektivste. Natürlich gibt es auch Dinge, die wir online gegen Filterblasen unternehmen können.
- Suche Artikel direkt auf der Quellseite und nicht auf Social Media: Versuche die Artikel Deiner Lieblingsnachrichtenportale am besten direkt auf deren Seite zu suchen und vertraue nicht darauf, dass Dir die soziale Medien diese vorschlagen. Das Ziel von Facebook, Instagram und Co. ist es Dich so lange wie möglich auf deren Plattform zu halten und das passiert leider nicht dadurch, dass Dir Beiträge von Nachrichtenportalen vorgeschlagen werden, die Dir nicht gefallen könnten. Schaue also in regelmäßigen Abständen auf verschiedenen Nachrichtenportalen vorbei und gehe nicht den Umweg über Soziale Medien.
- Bleibe bei Informationssuche uneingeloggt und lösche Cookies: Wenn Du Dich über ein Thema gezielt informieren willst, dann surfst Du am besten nicht eingeloggt, weder mit dem Google Konto, noch auf den Nachrichtenseiten. Benutze nach Möglichkeit auch verschiedene Browser, wie Google Chrome, Mozilla Firefox oder Opera. Machen wir uns nichts vor, auch durch Cookies lassen sich persönliche Informationen zwischen Seiten weitergeben, sodass den Portalen möglicherweise schon bewusst ist wer gerade surft. Aber wir müssen es den Portalen und Internetseiten auch nicht zu einfach machen und schon mit Namensschild die Seite betreten.
- Beschäftige Dich damit, was die großen Anbieter über Dich wissen: Die neue Datenschutzverordnung (DSGVO) mag den meisten nur bekannt sein, da man nun auf jeder Seite die Nutzung von Cookies annehmen oder ablehnen kann. Darüber hinaus muss dadurch aber auch jeder Anbieter die Informationen bereitstellen, die über eine Person bisher gesammelt wurden und sie auf Anfrage auch löschen. Schaue regelmäßig bei Deinen Anbietern, welche Daten sie über Dich angehäuft haben und für welche Dienste sie sie nutzen.
Was bewirken Filterblasen in einer Demokratie?
Für unserer liberalen Demokratie und öffentliche Debatte ist eine gemeinsame, faktenbasierte Diskussionsgrundlage aber essenziell. Fehlt diese in unserer Gesellschaft, weil jeder lediglich an seine eigenen (alternativen) Fakten glaubt, dann werden Argumente illegitim, nur weil sie von den eigenen Informationen und Ansichten abweichen. Das kann eine Polarisierung der Gesellschaft zur Folge haben und resultiert in Gruppierungen, die jeweils an eine eigene Wahrheit glauben, und jedes Verständnis für Andere verlieren. Der beschriebene Echokammer-Effekt führt dazu, dass Gleichgesinnte sich in ihren Ansichten gegenseitig online bestärken, gar aufputschen, ohne dass dabei eine Selbstreflexion stattfindet. Schnell kann es dann im digitalen Raum zu einer Radikalisierung kommen.
Um diesen Effekten entgegen zu wirken und eine Hyperpolarisierung der Gesellschaft zu verhindern – wie wir sie etwa gerade im politischen Geschehen der Vereinigten Staaten sehen – müssen wir jetzt handeln. Wir müssen die Algorithmen der sozialen Netzwerke stärker regulieren und mehr Transparenz im Netz fordern. Haben Nutzer Einsicht in jene personalisierten Parameter haben, die den Algorithmus entscheiden lassen, welche Inhalte er angezeigt, wird eine selbstbestimmte Entscheidung möglich. Google kündigte an das personalisierte Tracking ab 2022 einzustellen. Damit würden alle Nutzer in unserer digitalen Welt die gleichen Fakten sehen – zumindest in der Theorie. Es bleibt abzuwarten ob Social Media Unternehmen diesem Beispiel folgen werden.
Das solltest Du mitnehmen
- Filterblasen tauchen auf, wenn gezielt Informationen und Beiträge einem Nutzer nicht angezeigt werden.
- Es gibt verschiedene Möglichkeiten solchen Filterblasen zu entkommen oder sie zumindest unwahrscheinlicher zu machen.
- Wir müssen als Gesellschaft überlegen, wie wir mit Algorithmen umgehen, die solche Filterblasen unterstützen, ohne dass das ihre primäre Absicht ist.
Was ist Collaborative Filtering?
Erschließen Sie Empfehlungen mit Collaborative Filtering. Entdecken Sie, wie diese leistungsstarke Technik das Nutzererlebnis verbessert.
Was ist Quantencomputing?
Tauchen Sie ein in das Quantencomputing. Entdecken Sie die Zukunft des Rechnens und sein transformatives Potenzial.
Was ist die Anomalieerkennung?
Entdecken Sie effektive Techniken zur Anomalieerkennung. Erkennen Sie Ausreißer und ungewöhnliche Muster, um bessere Einblicke zu erhalten.
Was ist das T5-Model?
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit des T5-Modells für NLP-Aufgaben - lernen Sie die Implementierung in Python und Architektur kennen.
Was ist MLOps?
Entdecken Sie MLOps und erfahren Sie, wie es den Einsatz von maschinellem Lernen revolutioniert. Erkunden Sie die wichtigsten Konzepte.
Andere Beiträge zum Thema Filterblasen im Netz
- Eine ausführliche Seminararbeit der Universität Leipzig findest Du hier.
- Eine Studie zur Bundestagswahl 2017, bei der dieselben Suchbegriffe auf 1.500 verschiedenen, echten Accounts gefeuert wurden und die Ergebnisse analysiert wurden, ist hier verlinkt.

Niklas Lang
Seit 2020 bin ich als Machine Learning Engineer und Softwareentwickler tätig und beschäftige mich leidenschaftlich mit der Welt der Daten, Algorithmen und Softwareentwicklung. Neben meiner Arbeit in der Praxis unterrichte ich an mehreren deutschen Hochschulen, darunter die IU International University of Applied Sciences und die Duale Hochschule Baden-Württemberg, in den Bereichen Data Science, Mathematik und Business Analytics.
Mein Ziel ist es, komplexe Themen wie Statistik und maschinelles Lernen so aufzubereiten, dass sie nicht nur verständlich, sondern auch spannend und greifbar werden. Dabei kombiniere ich praktische Erfahrungen aus der Industrie mit fundierten theoretischen Grundlagen, um meine Studierenden bestmöglich auf die Herausforderungen der Datenwelt vorzubereiten.